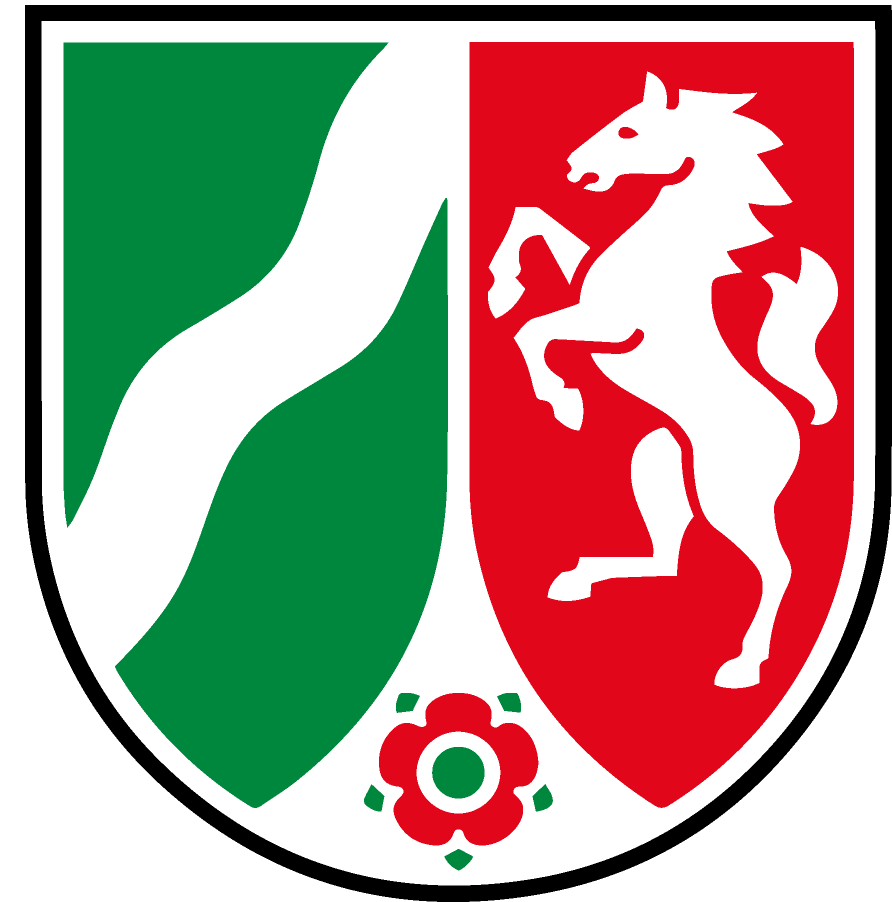 Die Bezirksregierung Köln hat im Rahmen der 2. Offenlage des Teilplans Erneuerbare Energien über 300 potenzielle Windkraftstandorte untersucht.
Die Bezirksregierung Köln hat im Rahmen der 2. Offenlage des Teilplans Erneuerbare Energien über 300 potenzielle Windkraftstandorte untersucht.
Die entsprechenden Unterlagen können auf der Webseite der Bezirksregierung heruntergeladen werden. Besonders interessant ist dabei das PDF-Dokument
A-1-4-4 Anhang C Prüfbögen.
Hier werden auf über 1.800 Seiten die einzelnen Windvoranggebiete hinsichtlich möglicher Umwelt-Einschränkungen analysiert - Basis für die konkreten Einwendungen.
Bürger können jetzt bis zum 7. August 2025 Stellung nehmen, am besten
per Email an:
ErneuerbareEnergien@bezreg-koeln.nrw.de .
In der Betreffzeile sollte der Standort angegeben werden, auf den sich die Einwendungen beziehen.
 Doch nicht jedes Argument ist gleich wirksam.
Doch nicht jedes Argument ist gleich wirksam.
• Allgemeine Hinweise auf die Schädigung von Natur und Umwelt, die Einschränkungen von Lebensqualität und Gesundheit der Bevölkerung oder den zweifelhaften volkswirtschaftlichen Nutzen von Windkraftprojekten werden erfahrungsgemäß übergangen.
• Hier sind 10 Strategien, mit denen Einwendungen fundiert und erfolgversprechend formuliert werden können – orientiert an den Prüfkriterien der Planung und typischen Fallkonstellationen.
1. Konkrete Schwächen benennen
Einwendungen, die präzise auf ökologische, technische oder soziale Schwächen hinweisen, sind schwieriger abzuwehren. Beispiele:
- Ökologisch: Horststandorte geschützter Arten (z. B. Rotmilan), Biotopverbund mit FFH-Gebiet
- Hydrologisch: Hanglage mit Bodentypen hoher Wasserspeicherfunktion – Retentionsverlust bei Starkregen
- Sozial: Abstände zu Wohngebiete, Freizeitanlagen, u.ä., Lärmimmissionen in Tallagen, Schattenschlag in Wohngebieten, Verlust von Erholungsflächen
„Eine Verschiebung innerhalb der Fläche ändert weder die hydrologische Situation noch den Schutzstatus angrenzender Biotope.“
2. Schein-Gutachten entkräften
Projektierer beauftragen oft eigene Gutachten. Diese sind rechtlich zulässig, aber nicht neutral:
„Das Umweltgutachten wurde vom Vorhabenträger beauftragt. Eine Bewertung durch eine unabhängige, öffentlich bestellte Stelle ist erforderlich, um den Anforderungen an das Vorsorgeprinzip (§ 15 BNatSchG) gerecht zu werden.“
Besonders kritisch sind Aussagen wie „keine signifikante Beeinträchtigung“ – diese sind oft Auslegungssache und wissenschaftlich schwer überprüfbar.
3. Minderungsmaßnahmen entwerten
Typische Reaktionen auf Einwendungen sind sogenannte „Minderungsmaßnahmen“. Diese sollen die Beeinträchtigung durch technische oder planerische Anpassungen reduzieren:
- Verschiebung des Windrads innerhalb der Zone
- Begrünung oder Aufforstung angrenzender Flächen
- Einbau von Drainagen oder Retentionsmulden
„Die Funktion des Waldhangs als natürlicher Wasserspeicher und Biotopverbund lässt sich nicht technisch ersetzen. Minderungsmaßnahmen kompensieren den Verlust nicht in seiner ökologischen Wirkung.“
4. Artenschutz, Biotopverbund und Erholungswert betonen
Viele Eingriffe treffen wertvolle Lebensräume. Einwendungen sollten betonen, dass:
- geschützte Arten nach Bundesnaturschutzgesetz betroffen sind (z. B. Fledermäuse, Greifvögel)
- der Biotopverbund unterbrochen wird – z. B. zwischen Waldgebieten oder Feuchtflächen
- ein anerkannter Naherholungsraum verloren geht
„Der betroffene Waldbereich wird regelmäßig von Spaziergängern, Reitern und Familien genutzt. Die Errichtung eines Windparks zerstört den Erholungswert dauerhaft.“
5. Auswirkungen auf Lebensqualität und Kulturlandschaft
Auch wirtschaftliche, gesundheitliche und kulturelle Aspekte sind legitime Einwendungsgründe:
- optische Dominanz und Schattenwurf beeinträchtigen Wohnqualität
- Lärm (auch tieffrequent) kann gesundheitliche Auswirkungen haben
- Tourismus- oder Kulturlandschaften (z. B. Kirchen, Burgen, Sichtachsen) verlieren an Attraktivität
„Die Windkraftanlagen stören die historische Sichtachse zwischen Dorf und Kirche und beeinträchtigen den Denkmalwert der Gesamtanlage.“
6. Planalternativen verlangen
Statt nur den Standort zu kritisieren, kann auch dessen Notwendigkeit insgesamt infrage gestellt werden:
„Warum wurde keine Nutzung von bereits erschlossenen Industrie- oder Konversionsflächen geprüft? Eine vergleichende Alternativenprüfung fehlt und ist gemäß § 2 Abs. 4 UVPG nachzuholen.“
So wird verhindert, dass Einwendungen lediglich durch Standort-Anpassungen beantwortet werden.
7. Flächenkonkurrenz sichtbar machen
- Windkraft verdrängt oft landwirtschaftliche oder touristische Nutzung
- Hinweis auf geplante Bebauung oder vorhandene Infrastruktur (z. B. Wanderwege, Biotope)
- Verweis auf kommunale Pläne, z. B. Bauleitverfahren oder Waldentwicklungsziele
„Ich fordere, dass bei der Flächenbewertung auch konkurrierende Nutzungsansprüche wie Tourismus, Naherholung, Forstwirtschaft oder zukünftige Siedlungsentwicklung berücksichtigt werden.“
„Die vorgesehene Fläche ist nicht frei verfügbar, sondern Teil bestehender oder geplanter Nutzungen, die durch Windkraft massiv beeinträchtigt würden.“
8. Vorbelastung betonen – „es reicht“
- Kumulative Belastung durch bestehende Windräder, Solaranlagen, Industrieanlagen
- Region trägt bereits mehr als ihren fairen Anteil an Energieinfrastruktur
- Angabe konkreter Zahlen (z. B. Anlagenzahl im Umkreis) unterstreicht das Argument
„Die Region ist bereits erheblich durch technische Bauwerke vorbelastet – eine weitere Konzentration von Windkraftanlagen ist den Menschen nicht zuzumuten.“
„Statt weitere Flächen zu opfern, muss die Verteilungsgerechtigkeit im Land beachtet werden – besonders belastete Regionen dürfen nicht zusätzlich benachteiligt werden.“
9. Risikoabschätzung rechtlich einordnen
Planer argumentieren oft mit „geringem Risiko“. Diese Einschätzung kann relativiert werden:
„Auch geringe Eingriffe in ökologisch überlastete Systeme können irreversible Kipp-Punkte auslösen. Das Risiko ist nicht quantifizierbar – deshalb muss das Vorsorgeprinzip zur Anwendung kommen.“
10. Fehlende Rückmeldung und Abwägungstransparenz
Ein wesentliches Problem vieler Beteiligungsverfahren besteht in der fehlenden Rückmeldung gegenüber Bürgern. Während Institutionen wie Kommunen, Verbände oder Behörden oft individuell eingebunden werden, erhalten Bürger lediglich eine automatische Eingangsbestätigung.
Die inhaltliche Bewertung der Einwendung erfolgt intern – häufig ohne konkrete Rückmeldung. Dies widerspricht dem demokratischen Anspruch auf transparente Beteiligung und erschwert die Nachvollziehbarkeit der Entscheidung.
„Im Sinne eines fairen Beteiligungsverfahrens fordere ich eine konkrete Rückmeldung zur Bewertung meiner Einwendung. Eine automatisierte Eingangsbestätigung genügt nicht. Ich bitte um Mitteilung, ob und in welcher Form mein Beitrag in die Abwägung eingeflossen ist.“
„Ich weise darauf hin, dass gemäß § 1 Abs. 7 BauGB alle Belange zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen sind. Eine pauschale Zusammenfassung bürgerlicher Einwendungen ohne differenzierte Bewertung erfüllt diese gesetzliche Vorgabe nicht.“
„Ich behalte mir vor, im weiteren Verfahren die ordnungsgemäße Beteiligung und Berücksichtigung meiner Einwendung gerichtlich prüfen zu lassen. Eine unterlassene oder fehlerhafte Abwägung stellt einen beachtlichen Verfahrensfehler dar.“
Falls keine qualifizierte Stellungnahme erfolgt:
„Hiermit machen ich den Informationsanspruch gemäß § 2 S.1 UIG NRW gegenüber der Bezirksregierung Köln geltend. Nach dieser Vorschrift hat nach Maßgabe des UIG NRW jede Person Anspruch auf freien Zugang zu Umweltinformationen ohne ein rechtliches Interesse darlegen zu müssen.
Nach § 2 Abs. 3 Nr. 3 UIG sind Umweltinformationen unter anderem Daten über Maßnahmen oder Tätigkeiten, die sich auf die Umweltbestandteile auswirken oder wahrscheinlich auswirken oder den Schutz von Umweltbestandteilen bezwecken. Damit sind menschliche Aktivitäten, die die Umwelt beeinträchtigen, wie beispielsweise behördliche Entscheidungen gemeint.
Betroffene Umweltbestandteile sind hier die Gebiete im Kreis Euskirchen, in die Windenergieanlagen gebaut werden sollen.“
Ich beantrage daher die Beantwortung der nachfolgenden Fragen:Bitte erteilen Sie mir eine schriftliche Eingangsbestätigung und die Auskunft spätestens innerhalb eines Monats.
- Sind die in meinem Schreiben vom 10.2.2025 geltend gemachten Einwendungen berücksichtigt worden?
- Wenn ja, welche Auswirkungen hatten meine Einwendungen auf die Änderungen des Aufstellungsbeschlusses?
- Wenn nein, aus welchem Grund wurden meine Einwendungen nicht berücksichtigt?
- Sind meine Einwendungen den Mitgliedern des Regionalrats zur Kenntnis gebracht worden?
- Wenn nein, aus welchem Grund wurde mein Schreiben den Mitgliedern des Regionalrats nicht zugeleitet?